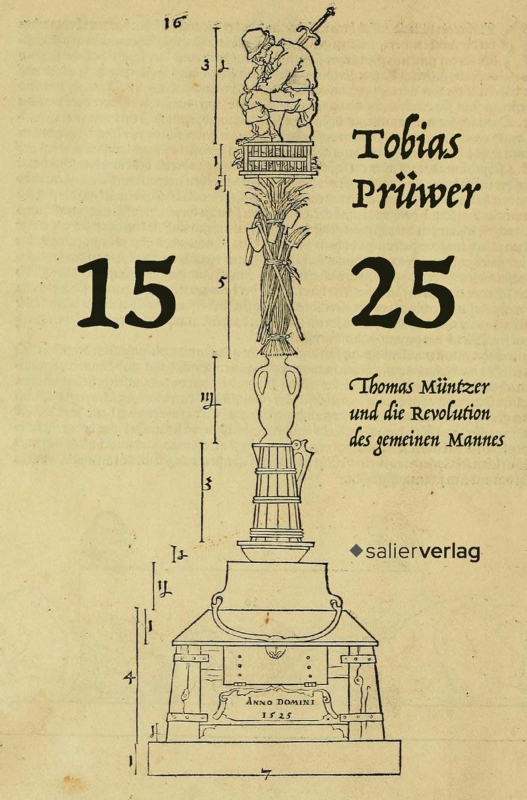Unter den Reformatoren des 16. Jahrhunderts zählt Thomas Müntzer (um 1489-1525) nicht unbedingt zu den bekanntesten – zumindest im Westen der wiedervereinigten Republik. In der ehemaligen DDR hingegen war der Prediger, Theologe und Revolutionär nahezu allgegenwärtig, war Namensgeber von Straßen und Plätzen, Bergwerksschächten und landwirtschaftlichen Kombinaten und etlichem mehr. Sein (fiktives) Konterfei prangte auf dem Fünf-Mark-Schein. Auch in Geschichtsschreibung und Schulbüchern wurde seine Rolle im „Deutschen Bauernkrieg“ deutlich stärker beleuchtet – und betont – als in der BRD.
Das lag nicht nur an seiner Herkunft aus Thüringen. Müntzers Kampf gegen die Obrigkeiten und für die Freiheit des „gemeinen Mannes“, vorgetragen in einer radikalen Rhetorik, prädestinierte ihn vermeintlich als Identifikationsfigur des selbsternannten Arbeiter- und Bauernstaates. Die zahlreichen Leerstellen in seinem Lebenslauf eröffneten zudem interpretatorische Spielräume und Projektionsflächen, sein gewaltsamer Tod verlieh ihm den Status eines Märtyrers.
Dass es sich bei Müntzers Utopie jedoch weniger um ein kommunistisches Paradies als um einen christlichen Gottesstaat handelte, wurde dabei geflissentlich ausgeblendet. Viele seiner Ansichten waren dabei nicht nur radikal, sondern erstaunlich modern. Ist der weitgehend in Vergessenheit geratene Reformator daher vielleicht doch auch heute noch relevant?
Das ist eine der Fragen, der Tobias Prüwer in seinem Werk nachspürt. Der Leipziger Journalist, Historiker, Philosoph und Autor hat weder eine Müntzer-Biographie verfasst noch eine Darstellung des „Bauernkriegs“, wenngleich dessen 500-jähriges Jubiläum natürlich den Anlass der Veröffentlichung bildet. Vielmehr bietet „1525“ eine Art Fallstudie zum frühesten flächendeckenden Aufstand des „gemeinen Mannes“ gegen „die da oben“, dem angesichts der jüngsten politischen ud gesellschaftlichen Entwicklungen in Deutschland nicht zum ersten Mal eine ganz neue Bedeutung zukommt.
Eine grobe Schilderung von Vorgeschichte, Anlass und Verlauf des „Deutschen Bauernkriegs“ sowie des persönlichen Werdegangs, der reformatorischen Theologie und sozialkritischen Radikalisierung Thomas Müntzers bilden den Rahmen einer geradezu geschichtsphilosophischen Betrachtung. Fast noch interessanter als das tatsächliche Wirken des Reformators ist nämlich sein Nachleben, seine Verteufelung durch die Einen, Glorifizierung durch die Anderen, und schließlich Vereinnahmung durch so unterschieldiche Ideologien wie Nationalsozialismus und DDR.
Auch hier zeigt die Geschichte zuweilen sehr moderne Züge, denn die Rufmordkampagne der gemäßigten Reformatoren um Martin Luther erinnert stark an heutige Verschwörungsmythen und fake news. Doch Geschichte wird von den Siegern geschrieben, und so hielt sich das im 16. Jahrhundert entstandene negative Bild vom „Satan von Allstedt“ bis ins 19. Jahrhundert, als das Pendel durch eine nicht weniger ideologisch geprägte Neubetrachtung und -deutung durch u.a. Friedrich Engels in die andere Richtung auszuschwingen begann.
Analog zur Person Thomas Müntzers erlebte auch der „Deutsche Bauernkrieg“ – Prüwer zeigt auf, warum diese Bezeichnung unglücklich ist und schreibt lieber und treffender von der „Revolution des gemeinen Mannes“ – in den vergangenen 500 Jahren diverse Um- und Neudeutungen: Als gewaltsamer Versuch, die gottgewollte Gesellschaftsordnung zu stürzen; als legitimer Protest gegen zunehmende Unterdrückung und Ausbeutung; als frühbürgerliche Revolution mit proto-kommunistischen Zügen; usw. Nicht zuletzt im Zusammenhang mit den teils gewaltsamen Protesten deutscher Landwirte in den vergangenen Jahren tauchte die Bezeichnung wiederholt in den Medien auf, um eine Traditionslinie zu kontruieren, von der in Wahrheit nicht im geringsten die Rede sein konnte.
Indem Tobias Prüwer diese Vorgänge beschreibt und analysiert, zeigt er zugleich die Mechanismen und Motivationen auf, die allgemein hinter der Vereinnahmung historischer Persönlichkeiten und Ereignisse stecken, und beleuchtet die Rolle der Medien: Im Fall der Aufstände von 1525/26 war es der noch recht neue Buchdruck, der es erstmals ermöglichte, große Menschenmassen mit Texten und vor allen Dingen Bildern zu erreichen. Letztere prägen mitunter noch heute unsere Vorstellungen vom „Bauernkrieg“ als gewaltsame Erhebung verwilderter Rotten von Landbewohnern, die mit Erntewerkzeugen wie Sicheln und Sensen bewaffnet in die Schlacht zogen, während sich in Wahrheit auch Bürger, Handwerker, Bergleute, Landsknechte und anderes „gemeines Volk“ an den Aufständen beteiligte, das seine Forderungen in erster Linie durch Verhandlungen durchzusetzen versuchte und im Falle einer bewaffneten Auseinandersetzung auf ein vorhandenes Arsenal von der einfachen Seitenwehr bis hin zu Geschützen zurückgreifen konnte.
Auch auf diese militärischen und sozialen Aspekte des sogenannten „Bauernkriegs“ geht Prüwer zumindest knapp ein. Tatsächlich sind die rund 160 Seiten seines Büchleins randvoll mit wertvollen Informationen, Gedanken, Assoziationen, Fragen und Antworten, so dass es sich lohnt, die recht kurzen Kapitel jeweils einzeln zu lesen und erst einmal für sich eine Weile wirken zu lassen. Gewisse Grundkenntnisse über die Zeit, Hintergründe, Verlauf und bedeutende Ereignisse des Aufstands sowie beteiligte Personen sollten dabei schon vorhanden sein, doch das umfangreiche Literaturverzeichnis zählt etliche Werke auf, die etwaige Lücken füllen können.
Prüwer lässt Zeitgenossen, Historiker und Künstler zu Wort kommen und zeigt so die ganze Bandbreite der Deutungen Müntzers und der Revolution des gemeinen Mannes vom 16. Jahrhundert bis heute auf. Deutlich wird dabei, dass sich die Vorstellungen des radikalen Reformators und der unzufriedenen Bevölkerung nur partiell in Deckung bringen ließen, ging es dem Einen doch um die Befreiung des Menschen von irdischen Sorgen und Nöten, um seine Seele für die Erkenntnis und Gnade Gottes empfänglich zu machen, während die Anderen die Abschaffung der Leibeigenschaft, Befreiung von als unrechtmäßig empfundenen Frondiensten und ähnliche ganz konkrete Erleichterungen ihres irdischen Daseins forderten.
Der einigende Begriff war der der Freiheit, wenn sie auch ganz unterschiedlich verstanden wurde, und darin findet sich die wohl stärkste Parallele zu unserer Gegenwart. Hier offenbart sich für Tobias Prüwer auch die Relevanz historischer Ereignisse wie des „Bauernkriegs“ und ihrer Protagonisten: „Es sind daher nicht die Antworten, sondern die Fragen von damals, die aktuell sind.“ (S. 127)
Salier Verlag, Eisfeld 2025. Geb, 168 S. ISBN 978-3-96285-073-9. € 22,-.