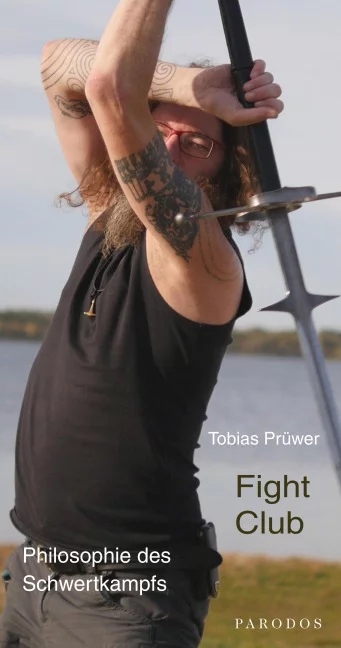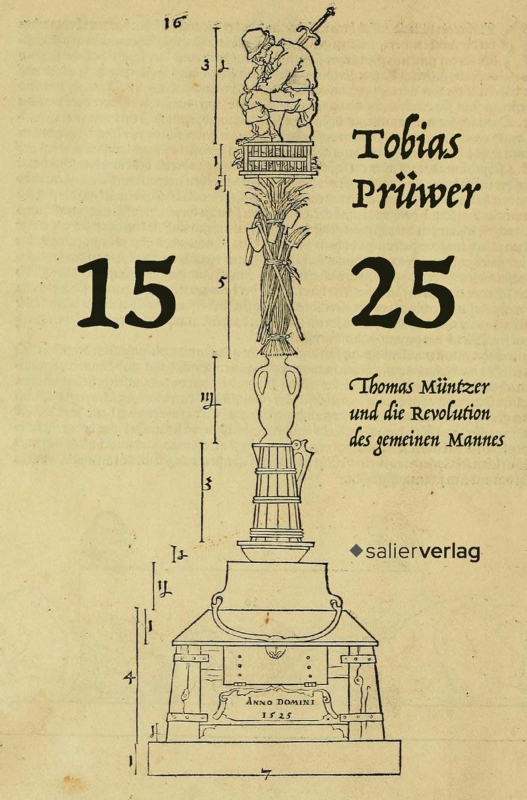Das Reimpassional, auch Altes Passional genannt, ist eine Sammlung von mittelhochdeutschen Heiligenlegenden in Reimform. Es entstand im 13. Jahrhundert sehr wahrscheinlich im Umfeld oder durch einen Angehörigen des Deutschen Ordens. Vorlage war wohl vornehmlich die lateinische „Legenda aurea“ des Jacobus de Voragine.
Darin findet sich auch die bemerkenswerte Geschichte der hl. Theodora, einer jungen, hübschen Frau, die ein glückliches und frommes Leben mit ihrem Ehemann führte. Das war dem Teufel ein Dorn im Auge, so dass er sie zum Ehebruch verleitete. Von Schuldgefühlen gequält, klagt und jammert sie, bis ihr Ehemann sie schließlich verlässt.
In ihrer Trauer und Scham ergreift Theodora daraufhin dratische Maßnahmen:
Schlagwort-Archive: Geschichte
Habitus (non) facit monachum?
Die Symbolik der Mönchskleidung und die Bedeutung des Kleiderwechsels in der mittelalterlichen Mönchsprofess

Zierinitiale: Mönch mit „Kutte“ und Tonsur. Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf, Ms. C 27, fol. 1r.
„Die Kutte macht noch nicht den Mönch“ weiß der Volksmund. Allerdings steht der Ausdruck „die Kutte nehmen“ metonymisch für den Eintritt in den Mönchsstand. Wie also gehören Kutte und Mönchwerdung zusammen? Welche Rolle spielte der Kleiderwechsel in der mittelalterlichen Mönchsprofess, d.h. der Weihezeremonie, die den Novizen zum Mönch werden ließ? Handelt es sich beim Habit der Mönche um ein geheiligtes Kleidungsstück oder ist er nur Arbeitskleidung, eine Art Standes- oder Berufsuniform? Weiterlesen
Die Kleidung der Geistlichen im Mittelalter
Die liturgischen Gewänder des Christentums entwickelten sich größtenteils aus der Kleidung der römischen Oberschicht. Die wesentlichen Bestandteile der geistlichen Trachten veränderten sich im Lauf des Mittelalters zwar zum Teil erheblich in Form und Aussehen, jedoch nicht in ihrer Funktion. Farbsymbolik und Accessoires beziehungsweise Insignien spielten dabei ebenso wie Material und Zier eine bedeutende Rolle, da sich in ihnen zum einen die Erhabenheit und Pracht des wahren Glaubens manifestierte, zum anderen die kirchliche Hierarchie beziehungsweise der Weihegrad ihres Trägers. Weiterlesen
Tobias Prüwer: Fight Club. Philosophie des Schwertkampfs
Tobias Prüwer war fleißig: Nur wenige Wochen nach seinem Buch über Thomas Müntzer und die Revolution des gemeinen Mannes ist bereits sein neuestes Werk erschienen – zu einem völlig anderen Thema.
Der Autor ist nämlich nicht nur Journalist, Historiker und Philosoph, sondern betreibt auch seit vielen Jahren als Lernender und Lehrender historische Kampfkünste, also den Umgang mit so altmodischen Wehren wie Schwert und Dolch. Und wie das so ist als Kulturwissenschaftler und Intellektueller, man kann gar nicht anders als sich mit den historischen, sozialen, philosophischen und psychologischen Dimensionen der eigenen Passionen kritisch auseinander zu setzen.
Die Ergebnisse seiner Überlegungen hat Prüwer nun in Schriftform zusammen gefasst und als Veröffentlichung im Berliner Parodos Verlag vorgelegt.
Tobias Prüwer: 1525. Thomas Müntzer und die Revolution des gemeinen Mannes
Unter den Reformatoren des 16. Jahrhunderts zählt Thomas Müntzer (um 1489-1525) nicht unbedingt zu den bekanntesten – zumindest im Westen der wiedervereinigten Republik. In der ehemaligen DDR hingegen war der Prediger, Theologe und Revolutionär nahezu allgegenwärtig, war Namensgeber von Straßen und Plätzen, Bergwerksschächten und landwirtschaftlichen Kombinaten und etlichem mehr. Sein (fiktives) Konterfei prangte auf dem Fünf-Mark-Schein. Auch in Geschichtsschreibung und Schulbüchern wurde seine Rolle im „Deutschen Bauernkrieg“ deutlich stärker beleuchtet – und betont – als in der BRD.
Das lag nicht nur an seiner Herkunft aus Thüringen. Müntzers Kampf gegen die Obrigkeiten und für die Freiheit des „gemeinen Mannes“, vorgetragen in einer radikalen Rhetorik, prädestinierte ihn vermeintlich als Identifikationsfigur des selbsternannten Arbeiter- und Bauernstaates. Die zahlreichen Leerstellen in seinem Lebenslauf eröffneten zudem interpretatorische Spielräume und Projektionsflächen, sein gewaltsamer Tod verlieh ihm den Status eines Märtyrers.
Dass es sich bei Müntzers Utopie jedoch weniger um ein kommunistisches Paradies als um einen christlichen Gottesstaat handelte, wurde dabei geflissentlich ausgeblendet. Viele seiner Ansichten waren dabei nicht nur radikal, sondern erstaunlich modern. Ist der weitgehend in Vergessenheit geratene Reformator daher vielleicht doch auch heute noch relevant?
Johann Preiser-Kapeller: Byzanz. Das Neue Rom und die Welt des Mittelalters
Die Geschichte des Mittelalters ist eine ausgesprochen westeuropäische Veranstaltung. Das betrifft nicht nur die Epochengrenzen, die in anderen Regionen völlig anders gezogen werden müssten, sondern z.B. auch die Betrachtung der Quellen. Schon ost- und südosteuropäische Länder wie Polen, Tschechien oder der Balkan spielen in der westlichen Geschichtsschreibung bestenfalls eine untergeordnete Rolle. Byzanz taucht allenfalls gelegentlich am Rand der Wahrnehmung auf, etwa wenn byzantinische Kunstwerke in angelsächsischen Grablegen auftauchen, ein Kreuzfahrerheer Konstantinopel plündert oder die Osmanen die Stadt schließlich erobern und in Istanbul umbenennen.
Zu diesem Zeitpunkt (1453) hatte „das andere Rom“ jedoch bereits seine eigene mehr als tausendjährige, wechselvolle und prägende Geschichte geschrieben. Sich mit dieser zu befassen kann nicht nur den eigenen geistigen Horizont erweitern, sondern eröffnet auch neue Perspektiven auf überregionale Konflikte, Handelspraktiken, religiöse Entwicklungen und andere Dynamiken.
Doch wo und wie soll diese Beschäftigung am besten beginnen? Die Antwort darauf liefert Johann Preiser-Kapeller mit seinem neuen handlichen Überblick, der – auf den ersten Blick etwas verwirrend – in der Reihe „Geschichte der Antike“ bei C.H. Beck erschienen ist.
Kursangebote von HistoFakt 2025
 Seit mehr als 10 Jahren bietet HistoFakt nun schon die beliebten Tageskurse Historisches Fechten mit dem Langen Schwert und Einführung in das intuitive Bogenschießen an – auch in diesem Jahr wieder an den bewährten Standorten Histotainment Park Adventon in Osterburken und Burg Gamburg in Werbach-Gamburg!
Seit mehr als 10 Jahren bietet HistoFakt nun schon die beliebten Tageskurse Historisches Fechten mit dem Langen Schwert und Einführung in das intuitive Bogenschießen an – auch in diesem Jahr wieder an den bewährten Standorten Histotainment Park Adventon in Osterburken und Burg Gamburg in Werbach-Gamburg!
In Zusammenarbeit mit der VHS Künzelsau findet 2025 zudem wieder ein mehrtägiger Kurs intuitives Bogenschießen in Krautheim/Jagst statt. Details siehe unten.
Die Kurse sind für Erwachsene und Jugendliche jeglichen Geschlechts ab 14 Jahren geeignet. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Die benötigte Ausrüstung wird zur Verfügung gestellt. Weiterlesen
Werner Meyer: Ein Krieg in Bildern und Versen
„Der Schwaben- oder Schweizerkrieg von 1499, geschildert von einem Zeitgenossen“
Der sogenannte Schwaben- oder Schweizerkrieg hat in der deutschen Geschichtsschreibung relativ wenige Spuren hinterlassen. Der militärische Konflikt zwischen der Eidgenossenschaft und dem Haus Habsburg sowie seinem wichtigsten Verbündeten, dem Schwäbischen Bund, währte von Januar bis September 1499, hatte jedoch eine jahrzehntelange Vorgeschichte und war eingebettet in ein viel weiter reichendes Ringen um die Vorherrschaft in Europa.
Unter den zahlreichen Quellen, die bereits während der Kampfhandlungen oder kurz danach entstanden, hat die Reimchronik des Nikolaus Schradin lange Zeit wenig Beachtung gefunden – zu gering erschienen ihr literarischer und historiographischer Wert, denn Schradin war nicht selbst Beteiligter oder Augenzeuge, sondern fasste die Erzählungen Dritter in etwas holprige und zuweilen schwerfällige Verse.
Kirchenburgmuseum Mönchsondheim
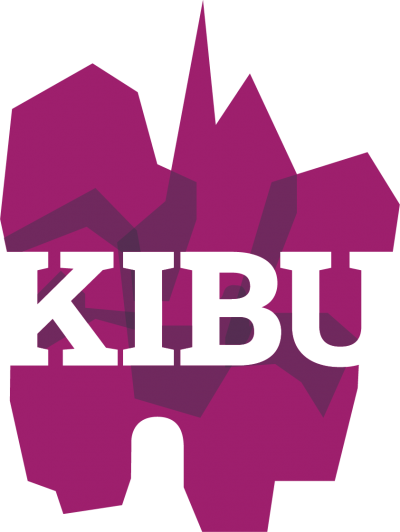 Im August 2023 ergab sich die Gelegenheit, im Anschluss an einen privaten Termin noch einige Tage in der Gegend um Kitzingen und Iphofen zu verbringen. Auf der Suche nach möglichen Ausflugszielen wurden wir auf das „Freilandmuseum Kirchenburg Mönchsondheim“ aufmerksam, das ich noch nie zuvor bewusst wahrgenommen hatte.
Im August 2023 ergab sich die Gelegenheit, im Anschluss an einen privaten Termin noch einige Tage in der Gegend um Kitzingen und Iphofen zu verbringen. Auf der Suche nach möglichen Ausflugszielen wurden wir auf das „Freilandmuseum Kirchenburg Mönchsondheim“ aufmerksam, das ich noch nie zuvor bewusst wahrgenommen hatte.
Es wurde beschlossen, dem beschaulichen Örtchen und dem „Kirche im Dorf“-Museum einen Besuch abzustatten. Das Areal schien von überschaubarer Größe zu sein, wir rechneten daher mit einem Ausflug von vielleicht zwei bis drei Stunden.
Um es vorweg zu nehmen: Am Ende waren es fast sechs überaus interessante, lehrreiche und erfreuliche Stunden, die wir in Mönchsondheim verbrachten!
Der heilige Sebastian
Sebastianus stammte wahrscheinlich aus Narbonne im Süden Frankreichs und aus „gutem Hause“. Er wuchs in Mailand auf, wo er Kaiser Diokletian auffiel, der seine Aufnahme in die Prätorianergarde veranlasste. Diese Elitetruppe bildete die persönliche Leibwache des Kaisers, sie erhielt deutlich höheren Sold als die übrigen Truppen und genoss zahlreiche weitere Vorteile. Sebastian stieg in den Rang eines Hauptmanns auf – die Aussichten auf eine sichere, wohlhabende Zukunft und ein angenehmes Leben standen gut für den jungen Mann.