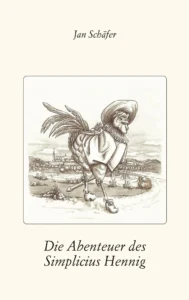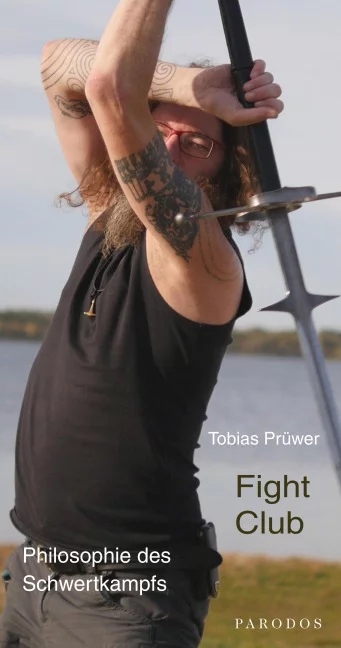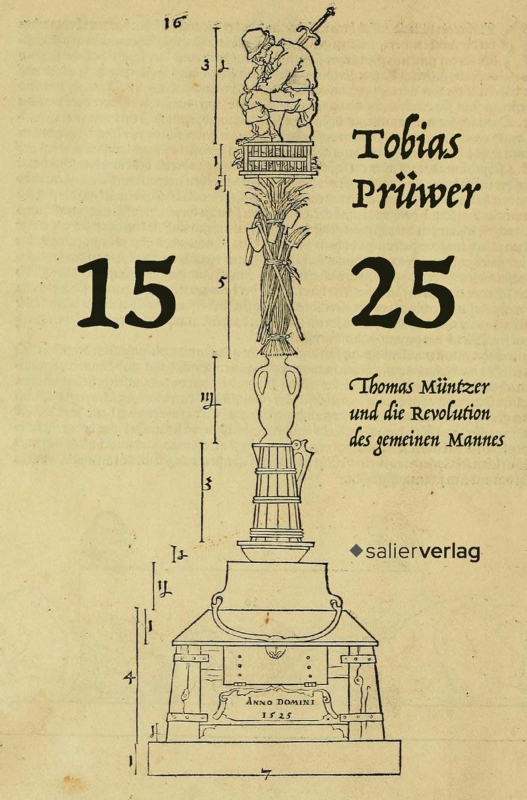Zum 20jährigen Firmenjubiläum von HistoFakt. Historische Dienstleistungen gibt es einige Neuerungen in unserem Kursprogramm!
Neben den bewährten Standorten Burg & Burgpark Gamburg (Werbach-Gamburg) und Histotainment Park Adventon (Osterburken) finden im Juli und September nun auch Kurse am Schloss Neunstetten in Krautheim-Neunstetten statt.
Auf vielfachen Wunsch von Teilnehmenden der vergangenen Jahre steht nun auch ein Aufbaukurs historisches Fechten (am 26. Juli 2026) auf dem Programm.
NEU sind auch die Preisnachlässe, wenn bis zu vier Plätze in einem Kurs gleichzeitig gebucht werden. Familien oder Gruppen können so richtig Geld sparen!
Für Gruppen ab 5 Personen besteht weiterhin die Möglichkeit, individuelle Termine zu vereinbaren.
Neben den Tageskursen gibt es im Juni auch wieder Angebote zum Bogenschießen und historischen Fechten in Kooperation mit der VHS Künzelsau mit 5 Terminen à 2 Stunden.
Die Kurse sind für Erwachsene und Jugendliche jeglichen Geschlechts ab 14 Jahren geeignet. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Die benötigte Ausrüstung wird zur Verfügung gestellt. Weiterlesen